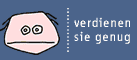| |||||
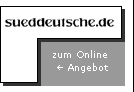 |
 |
|
Eine mobile Form der Outdoor-Kultur etabliert sich: Die „Strandbox“ schafft temporäre Ereignisräume an ausgewählten Kölner Orten Köln – Mal gastiert die „Strandbox“ im Kölner Rheinpark – dann denken die Passanten, dort gäbe es leckeres Eis zu kaufen. Mal versammeln sich auf dem Wallraffplatz vor dem WDR rund 30 Leute um das Bar- Fahrrad, um einem Laptop-Konzert beizuwohnen. Da kann es schon mal passieren, dass jemand wegen Ruhestörung die Polizei ruft. Oder Merlin E. Bauer parkt sein Rad mit angebauter Kühltruhe und Schirmdach auf der kleinen Palmeninsel oberhalb der Nord-Süd-Fahrt, um einen Architekten-Vortrag zum Thema „psycho- dynamische Straße“ gastronomisch zu flankieren. Auf vorbei brausende Autofahrer mag das wie eine Kleindemo wirken. Seit Anfang August sorgt die „Strandbox“ für Verwirrung an öffentlichen Plätzen Kölns und ist mittlerweile Stadtgespräch. Nicht länger soll Outdoor- Kultur hier nur den Freizeitsportlern, dem Ringfest, Karneval und anderen Events überlassen werden. Es geht um eine Wiederaneignung öffentlichen Raums mittels themen- und ortsspezifischer Veranstaltungen, die nicht ausschließlich der Unterhaltung dienen. Getreu dem Motto „Unter dem Pflaster der Strand“ – übrigens durchaus als Referenz an die 68er – findet sich zwei- bis dreimal pro Woche eine wachsende Zahl von Leuten zu unterschiedlichen Anlässen an wechselnden Orten zusammen. Zum netten Tischtennisturnier im Klingelpützpark, zur Besichtigung eines Kräutergartens im Stadtgarten oder zur Live-Übertragung des ersten Zweitliga-Saisonspiels des 1. FC Köln; mal als „kalter Kaffee zur Popkomm“, zum Vortrag über Stadtentwicklung eines Architektenbüros oder zum Konzert des Elektronik-Musikers Marcus Schmickler im Gedenken an das legendäre „Studio für elektronische Musik“ des WDR, das vor eineinhalb Jahren geschlossen wurde. Es gibt auch was zu essen Merlin E. Bauer, der Kopf und Organisator, versteht seine „Strandbox“ als mobiles Forum für Kunst und Kultur, in möglichst großer Bandbreite. Neben der musikalischen Beschallung über kleine UKW-Radios gehört das kulinarische Angebot zum Konzept: Essen und Trinken werden Ort und Thema angepasst. So gab es zur Feier des 28. Geburtstages (gleichzeitig Einmonats-Jubiläum der „Strandbox“) des aus Graz stammenden Bauer jüngst unter den Platanen des Friedensparks österreichische Spezialitäten, dazu auf der Videoleinwand „Kottan ermittelt“ oder „Der dritte Mann“. Zur demnächst geplanten „kölnischen Tafel“ auf dem Gelände der ehemaligen Chemischen Fabrik in der Industriebrache Kalk wird ein „lokalpatriotisches“ Drei-Gänge-Menü inklusive Flönz und Pflaumenkuchen angeboten. Bauer hat früher einmal gegenüber dem alten CFK-Areal gewohnt, das nun peu à peu saniert wird: Die Brache vom Deutzer Bahnhof bis nach Kalk gehört zu den zentralen Stadtentwicklungsprojekten. „Seit kurzem befindet sich hier das neue Polizeipräsidium, wir sitzen dann beim Essen quasi unter Aufsicht der Polizei“, sagt Bauer und schmunzelt. Hinter seinem Elan steht das Begehren, das urbane Umfeld immer wieder neu zu erfahren, zu beleben, zu definieren. Für ihn sind es gerade die kleinen Ecken der Stadt, die man oft achtlos passiert und die sich deswegen besonders dazu eignen, einen „uncodierten, sozialen und temporären Raum zu schaffen und auch das Verhalten Kölns darin aufzunehmen“. Da sich die lokalen Kulturpoduzenten nicht unbedingt durch Mobilität auszeichnen würden, sagt Bauer, blieben die Szenen oft unter sich und voneinander abgeschottet. Ein bisschen mehr Bewegung im Stadtraum – wie das Beispiel Berlin gezwungenermaßen zeigt – kann nicht schaden. Durch die „Strandbox“ soll es zu mehr Berührungen kommen, aber nicht unbedingt nur innerhalb der strengen Kaste von Kunst und Kultur. Interessierte aus allen Kreisen und gesellschaftlichen Schichten sind willkommen, die mobile Bar für sich zu nutzen. „Ich bin nur der Kommunikator“, sagt Bauer. Letzte Woche etwa habe das Architekturbüro BeL einen Abend gestaltet, genauso könne es aber auch der Hausmeister Krause aus Kalk machen, wenn der einen tollen Hinterhof hat und dort etwas über seine Arbeit erzählen will. Genossenschaftliches Modell Erstaunlich ist, welch breite Unterstützung das Projekt bisher erfahren hat. Dank Spenden und Zuwendungen von Einzelpersonen und Institutionen konnte die „Strandbox“, deren Anschaffungspreis sich durchaus im Bereich eines Kleinwagens bewegt, in einem genossenschaftlichen Modell finanziert werden. Viele Galeristen sind beteiligt – etwa die namhaften Galerien Sprüth, Buchholz, Nagel und Jablonka – und Kulturschaffende wie Wolfgang Strobel, der Vorsitzende des Kölnischen Kunstvereins, oder Michael Erlhoff, Gründungsdekan der FH Design in Köln; zudem Schauspieler, Regisseure, auch der Plattenladen A-Musik, weit über die Stadtgrenzen bekannter Fachhändler für experimentelle elektronische Musik. Bauer hat kleine Verträge abgeschlossen, wodurch die Teilhaber auf zwei Jahre fest mit dem Projekt verbunden sind. Zur Eröffnung der „Art Cologne“ im November sollen auf einem Kunstfest im Deutzer Bahnhof dann auch die ersten drei Monate der „Strandbox“ dokumentiert und im Winter ein kleines Vereinslokal eröffnet werden, für kreative Begegnungen. Schnell ist man auch außerhalb Kölns auf die mobile Plattform aufmerksam geworden: Es gibt bereits Einladungen vom Frankfurter Kunstverein, vom Berliner Techno-Club WMF und aus Las Vegas. Dort wird das
Bar-Rad am 5. Oktober bei der größten Bike-Show in der
Wüste von Nevada mitrollen und der deutschen Klischee-Zuschreibung
„Kraut“ mit entsprechendem kulinarischen Angebot begegnen. Im nächsten
Frühling wird sich Merlin E. Bauer dann auf große Fahrt
zu Kölner Partnerstädten wie Turin und Barcelona begeben
– auch ein kulturelles Austauschprogramm ist in Planung. OLAF KARNIK |
Aktuelles Lexikon Wochenchronik Kontakt Impressum 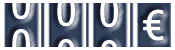 | ||
| zurück Seitenanfang sueddeutsche.de |
||
| Copyright
© sueddeutsche.de GmbH/Süddeutsche Zeitung GmbH Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten Beiträge, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne vorherige Zustimmung unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urhebergesetz nichts anderes ergibt. Artikel der Süddeutschen Zeitung lizenziert durch DIZ München GmbH. Weitere Lizenzierungen exklusiv über http://www.diz-muenchen.de/. |
||